- Kultur
- Komische Oper Berlin
»Das Floß der Medusa«: Ahoi, Probleme dieser Welt!
Tobias Kratzer stört mit seiner furiosen Inszenierung von Hans Werner Henzes Oper »Das Floß der Medusa« am Flughafen Tempelhof den Glamour des Berliner Kunstbetriebs auf

Es sind einfach zu viele. Rechts die Frau im Abendkleid, links der Mann im Smoking, ein Hektischer tritt einem die Lederschuhe in die Hacken, eine mit Tasche malträtiert einem das Kreuz. Gedrängel, Geschiebe, Gemurmel. Gerüche, Gehuste, Geschimpfe. Jeder will auf seinen Platz, doch 1600 Menschen, das sind einfach zu viele. Viel zu viele Menschen, die hier in den Hangar 1 des geschlossenen Tempelhofer Flughafens in Berlin drängen. Viel zu viel Wille. Viel zu viel – wie? Diese »Vielzuvielen« haben immerhin noch viel zu viel Geld? Denn sonst wären sie ja nicht hier, bei der Eröffnungspremiere der Komischen Oper? Ja. Noch! Aber wer weiß, wie es weitergeht? Mit der Inflation? Dem Krieg? Dem Wohlstand in Deutschland. Deshalb kappen wir lieber das Seil. Lassen die anderen Vielen, die viel zu schlechte Jobs haben, die von viel zu weit her kommen, die viel zu zahlreich um Unterstützung, um Solidarität, um Aufnahme bitten, auf See. Ahoi, Probleme dieser Welt! So. Und nun erst mal Prost!
Tobias Kratzers Inszenierung von Hans Werner Henzes »Das Floß der Medusa« ist ein furioser, wütender, den Gleichmut und Glamour des Kunstbetriebs aufstörender Spielzeitauftakt der Komischen Oper Berlin. Diese hat sich seit dem Sommer auf ein sanierungsbedingtes Nomadentum begeben. Neben dem Schiller-Theater als festem Quartier wird sie unter anderem den Flugzeughangar am Tempelhofer Feld bespielen. Ein Ort, an dem die Extreme der Gegenwart mitsamt ihren historischen Verkabelungen offen zutage liegen: Nazi-Bau, Ort der Berliner Luftbrücke, innerstädtischer Flughafen, Naherholungsgebiet, Flüchtlingsunterkunft. Noch heute steht hier neben Drachenfest und Skaterpark ein Containerdorf für Asylsuchende. Und auch wir, die Premierengäste, blicken, vor Vorstellungsbeginn auf dem Rollfeld stehend, auf diese Landschaft aus weißen Kuben. »Schau mal«, ruft eine Frau, »ein Feuerwerk!« und zückt freudig ihr Handy. Probleme, ahoi.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Henze hatte, als er, inspiriert von den 68ern, »Das Floß der Medusa« schrieb, genau jene auch globalen Unrechtsverhältnisse zwischen Arm und Reich, Macht und Ohnmacht vor Augen, wie sie grob gesagt noch heute bestehen. So kam er auf den Stoff der Medusa, einer Tragödie, bei der 1816 auf dem Weg in die Kolonie Senegal nach einer Havarie der französischen Fregatte Medusa über einhundert Menschen starben – auf einem selbst gebauten Rettungsfloß verdurstet, verhungert, sich selbst ein Ende setzend oder von Mitreisenden ermordet. Die Oberschicht der Fregatte hatte sich pikanterweise zuvor in den wenigen vorhandenen Rettungsbooten aus dem Staub gemacht und das Verbindungsseil zum Floß gekappt. Der französische Maler Théodore Géricault erschuf 1819 in Erinnerung an diese menschenverachtende Tat sein ikonisches Gemälde »Das Floß der Medusa«.
In dem großen quadratischen Wasserbassin, an dessen zwei Seiten sich wie bei einem Schwimmwettkampf riesige Zuschauertribünen gegenüberstehen, sehen wir bereits beim Betreten der Halle das Gemälde als »lebendes« Remake: dahingeraffte Körper auf hölzernen Planken, zerrissene Kleidungsstücke und den zum Horizont gerichteten Blick des Matrosen Jean-Charles, der vorne steht und mit einem roten Tuch versucht, Schiffe anzulocken (Bühne und Kostüme Rainer Sellmaier). Kurz hat man Gelegenheit, die Skandalgeschichte von Henzes Werk Revue passieren zu lassen, dessen Uraufführung 1968 in Hamburg aufgrund eines am Dirigentenpult angebrachten roten Tuches in Tumulten unterging, da entledigt sich die Inszenierung auch schon dieses größten Musiktheaterskandals aller Zeiten, um in einem vielschichtigen Resonanzraum aus Ressourcenknappheit, Migrationsbewegungen, postkolonialer Schuld, Klassengegensätzen und Klimawandel zu eigener Aussagekraft zu finden.
Noch bevor der erste Ton erklungen ist, zerrt unter Knarzen und Schleifen Idunnu Münch in ihrer Rolle des Erzählers Charon ein Sea-Watch-Rettungsboot in das Bassin. Damit fängt das Spiel der Deutungen an, das sich an diesem Abend als gewaltiger Kraftakt entlädt, getragen von über 150 Spielenden, Chorsolisten, Bewegungschor, Kinderkomparserie, dem Vocalconsort Berlin, dem Staats- und Domchor Berlin, dem Orchester der Komischen Oper unter Titus Engel sowie drei grandiosen Solisten, neben Münch sind das Günter Papendell als Jean-Charles und Gloria Rehm als der Tod. Die Stärke von Kratzers Regieansatz ist die völlige Abwesenheit von Agitprop. Natürlich denkt man bei Floß und Tod an die Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer. Aber die Rekonstruktion derartiger Katastrophen durch Kunst, zumal durch ein überwiegend weißes Ensemble wäre anmaßend. Die Inszenierung arbeitet anders, sie schafft ohne Aneignung komplexe Bilder, die mit ihrer teils erstaunlich spielerischen Ironie ein Berliner Publikum umso härter treffen.
Die Schiffsgesellschaft jedenfalls – es lässt sich ja nicht wegblenden: Ober- wie Unterschicht segelten damals mit dem Ziel der Kolonialisierung gen Senegal – gleicht jener Menge auf den Rängen: Abendkleider, weiße Hemden, überwiegend weiße Haut. Als die Medusa Teneriffa passiert, stürzen sich Badende vergnügt ins Wasser, deren quietschbunte Plastikinseln in Ananasform neben dem Sea-Watch-Boot nahezu vulgär wirken. Aber so ist es: Wer Urlaub am Mittelmeer macht, planscht in einem Massengrab.
So geht es hin und her: Während die Nachrichtenbilder vom überfüllten Lampedusa ständig im Kopf kreisen, drängt, zieht, schubst sich eine Abendgesellschaft auf dem Floß – für diesen kleinen Flecken Holz schlicht zu viele. Dass die »Sea-Watch-Aktivistin« Idunnu Münch of color ist, erlangt in diesem Kontext insofern Bedeutung, dass die medialen Bilder uns ständig den umgekehrten Fall erzählen. Diesmal aber ertrinken hauptsächlich Weiße. Als Ex-Kolonialisten und damit Mitverursacher globaler Missstände? Als Mittelständler, die nun auch um ihren – in Relation zu Geflüchteten noch sehr wohligen – Wohlstand fürchten? Oder schlicht: Als von anderen brutal abgehängte Menschen? Auch dies bleibt in der Schwebe.
Der Abend, bei dem man – einziger Wermutstropfen – Henzes apokalyptischer Musik und Ernst Schnabels poetischem Libretto in der großen Halle mitunter hinterherhorchen muss, umkreist assoziationsreich ein grundlegendes Motiv: Wie es ist, leben zu wollen – ohne zu verhungern, ohne zu verdursten –, während die dafür notwendigen Ressourcen schlicht knapper werden.
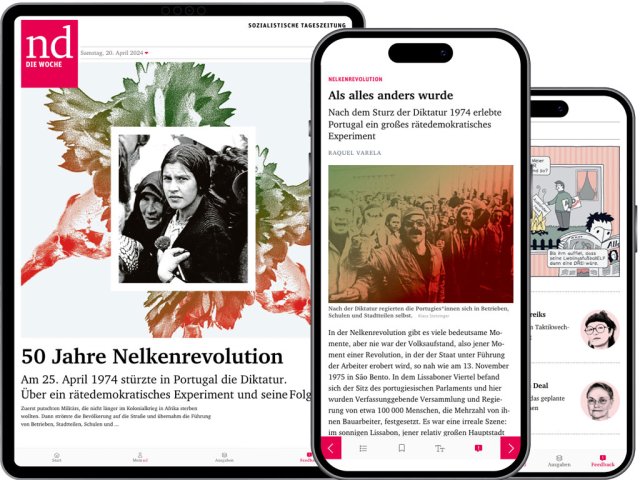
In der neuen App »nd.Digital« lesen Sie alle Ausgaben des »nd« ganz bequem online und offline. Die App ist frei von Werbung und ohne Tracking. Sie ist verfügbar für iOS (zum Download im Apple-Store), Android (zum Download im Google Play Store) und als Web-Version im Browser (zur Web-Version). Weitere Hinweise und FAQs auf dasnd.de/digital.
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.









